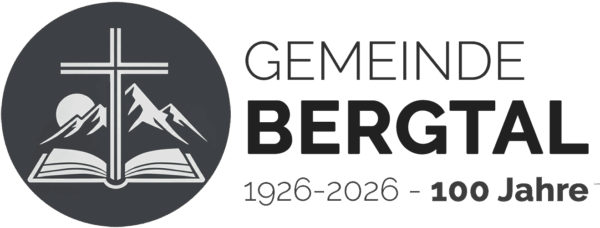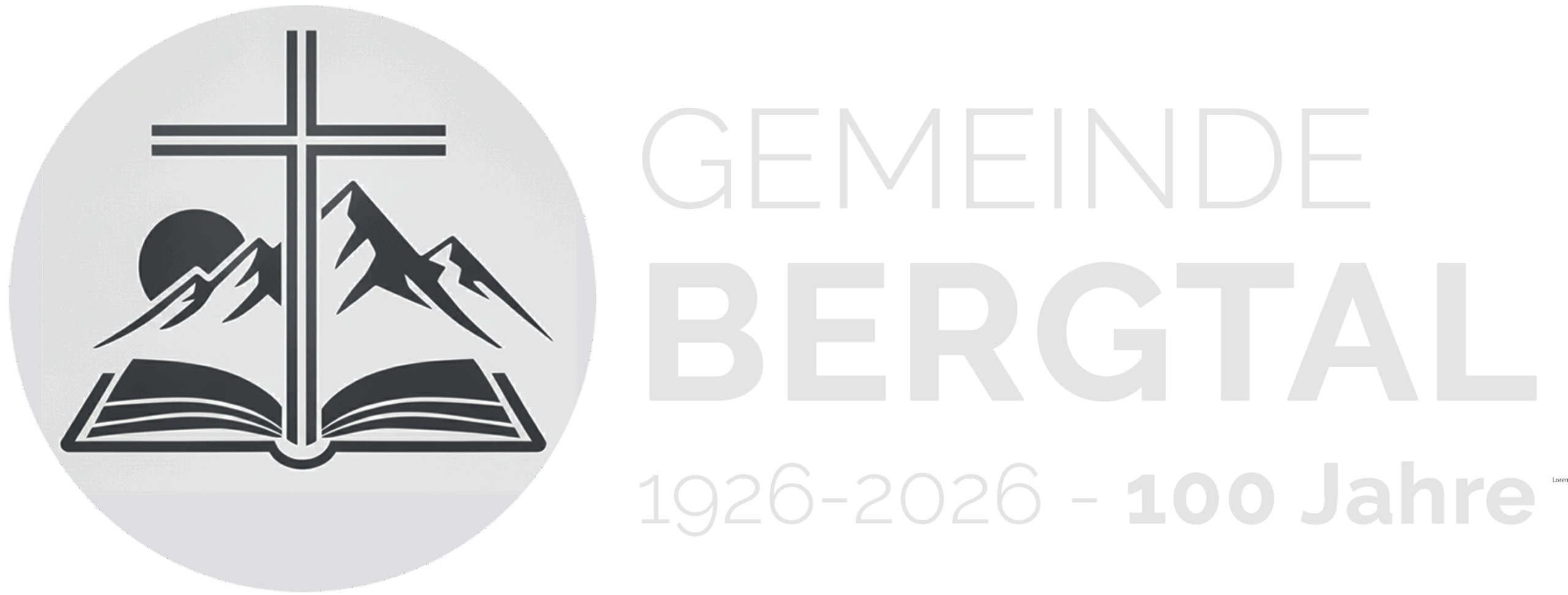Rudolf Koop (zweite von links) mit Kirgisen in den Bergen beim Kumys-trinken. Ganz rechts im Bild seine Frau Lydia
Auch Rudolf Koop, der in seiner Kindheit fast das gleiche wie Eduard Giesbrecht erlebte, gehört zu den Männern, die den Kirgisen in ihrer Sprache von Jesus Christus und vom christlichen Glauben bezeugt haben.
Rudolf hatte die zweite Schulklasse noch nicht beendigt, als er, um nicht zu verhungern, das Lernen abbrach und zu den Kirgisen in die Berge ging, ihre Schafe zu hüten.
Seine Mutter saß wegen der Flucht aus der Trudarmee im Gefängnis. Er aß, schlief und wohnte bei den Kirgisen in den Jurten und erlernte somit einwandfrei ihre Sprache. Die Kirgisen waren nett zu ihm. Weil er seinen Geschwistern zu Hause nicht helfen konnte, nahm er für längere Zeit einen seiner Brüder zu sich in die Berge und teilen das spärliche Essen, auch Freude und Leid mit ihm. Acht lange, schwere Jahre in Hunger und Kälte durchlebte er in den Bergen, aber auch schöne Sommertage, wenn mal der Magen nicht knurrte.
Mit 18 Jahren begann er wieder im bergischen Dorf „Arpotektor“ die Schule zu besuchen, brach jedoch nach Beendigung der 4. Klasse das Lernen ab. In seiner Jugendzeit lernte er Lydia Voth kennen und am 27. Februar 1955 feierten sie ihre Hochzeit. Im Jahre 1979 wurden beide nach ihrer Bekehrung getauft und in die Gemeinde aufgenommen.
Aufgrund seiner kirgisischen Sprachkenntnisse war er überall bekannt und beliebt. Ob Rajonverwaltung, Ministerium, Polizei oder andere Instanzen, – überall hatte er Zutritt und konnte daher manch einem Bürger aus der Patsche helfen. Außerdem verfügte er über eine besondere Gabe, Menschen anzusprechen und sie zu überzeugen. Wenn er gefragt wurde, wo er studiert habe, kam die Antwort: „Im Arpotektschen Institut!“ Er fuhr oft mit anderen Brüdern mehrere hundert Kilometer in die Berge, zu den weit abgelegenen Kirgisendörfern und erzählte ihnen in ihrer Sprache von Jesus. Selbstverständlich war er nicht fehlerlos und hatte, wie alle anderen Menschen seine Schattenseiten.
Die Berge und Kirgisen bleiben ihm ein Stück Heimat und er hielt sich dort gerne auf. Die Kirgisen staunten und hörten ihm gerne zu, sie wollten es ihm aber nicht recht glauben, dass er ein Deutscher sei. Eigentlich war er mit seiner dunklen Haut, dunklen Augen und schwarzem Haar mehr einem Usbeken oder Tschetschenen, als einem Deutschen ähnlich. Außerdem sprach er auch gut russisch.
Er hatte immer offene Augen und ein offenes Herz für Arme, Witwen, Waisen und Notleidenden. Auch lieh er oft Geld und Sachen aus, wo keine Aussicht war, es jemals wiederzubekommen.
Einem älteren Kirgisen, in einem weitab gelegenen Kirgisendorf, der zwar einen Esel, aber keinen Wagen besaß, besorgte Rudolf einen leichten „Eselswagen“ auf Gummireifen, der in Bergtal angefertigt und mit einem Anhänger dorthin transportiert wurde. So etwas hatte der Kirgise noch nie gesehen. Seine Freude darüber kann man sich nur vorstellen.
Bei einem Besuch in einem anderen Kirgisendorf wollten die Brüder vor der Abfahrt noch ein Foto schießen. Ein verwahrloster, ungepflegter Kirgise schämte sich und wollte nicht mit fotografiert werden. Da ging Rudolf zu ihm, holte seinen Kamm aus der Tasche und indem er ihm etwas in seiner Sprache ins Ohr flüsterte, kämmte er ihm das Haar. Daraufhin konnte das Foto gemacht werden.
Doch alles hat seine Zeit, die oft viel zu schnell vergeht. Im Jahre 1999 erkrankte Rudolf schwer. Als es ihm wieder etwas besser ging und er wieder in die Berge ritt, stürzte sein Pferd und er kam unter diesem zum Liegen. Seitdem ging es mit seiner Gesundheit rapide bergab und am 28. Januar 2000 ging er heim zu seinem Heiland. Drei Tage lang kamen viele Kirgisen zur Trauerfeier und alle wurden mit Essen bewirtet, so wie es in ihrem Volk üblich war, während wir Deutsche die Beerdigung nur einen Tag feiern. Es ist Tatsache, dass eine der größten Brücken zwischen den Deutschen und den Kirgisen in unseren Dörfern und Umgebung, durch seinen Heimgang abgebrochen wurde!
Quelle: aus dem Buch „Unsere Heimat war Bergtal im Tschu-Tal“ von Werner Suckau